Die Trilogie über die vielen Frieden
Die Trilogie Variationen über die vielen Frieden, wurde zwischen 2008 und 2015 auf Deutsch erstveröffentlicht. Sie beschreibt die Entwicklung vom ursprünglich postmodernen Konzept der vielen Frieden über transrationale Friedensphilosophie und elicitive Konflikttransformation bis hin zur Praxis des Elicitive Conflict Mapping.
Die Nachbemerkung wurde statt einer überarbeiteten und aktualisierten Neuauflage der ursprünglichen Bände geschrieben. Sie vollzieht den Schritt von den vielen Frieden zum Frieden als Geschehen und Tun im Rahmen eines immanenten Weltbildes.

Band 1 erschien unter dem Titel Deutungen im Jahr 2008. Er basiert im Wesentlichen auf postmoderner Philosophie in der Tradition Jean Francois Lyotards oder Richard Rortys und der interpretativen Ethnologie Clifford Geertz‘. Vor allem aber beruft er sich auf die Humanistische Psychologie nach Abraham Maslow und Carl Rogers. Er beschreibt zuerst das Verständnis des Begriffs Frieden in unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexten vom Altertum bis in die Gegenwart. Diese post-strukturalistische `Archäologie´ beleuchtet ausgewählte Friedensvorstellungen aller Kontinente. Das Buch teilt diese in fünf unterschiedlichen Interpretationsgruppen. Salopp bezeichnet es sie als „Friedensfamilien“ : die energetischen, die moralischen, die modernen, die postmodernen und die transrationalen.
Dieser Zusammenschau folgt die Entwicklung des transrational genannten Ansatzes. Der war in seiner Zeit eine Innovation für die Disziplin der Friedensforschung. Denn er stellte keine Friedensdeutung „zivilisatorisch“ oder „tribalistisch“ über eine andere. Er betrachtet jede von ihnen als relevant, sofern sie sozialmächtig war oder ist. Transrationalität anerkennt alle Errungenschaften des aufgeklärten Wissenschaftens. Sie betrachtet über die reine Vernunft hinaus alles Menschliche, Allzu menschliche als bedeutend für das Wahrnehmen, Verstehen, Spüren, Leben und Erleben von Frieden in Zusammenhängen von Menschen und ihrer Mitwelt. Der Frieden hat weder Grund noch Ziel. Der Sinn des Friedens liegt im frieden.
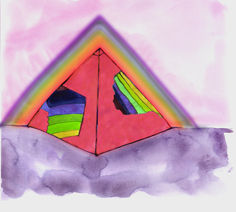
Band 2 befasst sich mit Elicitiver Konflikttransformation (2011). Den Begriff elicitiv prägte John Paul Lederach in den 1990er Jahren. Er meinte damit jenen Zugang zur angewandten Friedensarbeit, welcher die transformative Kraft von Konflikten in der direkten Beziehung der jeweiligen Parteien erwartet. Deshalb liege die Aufgabe Dritter darin, sichere Begegnungsräume und Kommunikationsstrukturen zur Verfügung zu stellen, nicht aber sich selbst inhaltlich als Befrieder einzubringen. Lederach grenzte diesen Zugang von der präskriptiven Konfliktlösung ab, bei der die Expertise und das Modell der Vermittler eine zentrale Rolle spielen. Aus dem unterschiedlichen Anspruch an die Konfliktarbeit und deren Agenden, aus dem unterschiedlichen Verständnis von Konflikt an sich und der Rolle von Konfliktparteien ergeben sich erheblich abweichende Zugänge zur Praxis der Konfliktarbeit.
Elicitive Konflikttransformation ist die praktische Konsequenz transrationaler Friedensphilosophie. Dieser Band zeichnet dies im Detail als paradigmatische Wende der Denk- und Arbeitsweise in der Diplomatie, bei militärischen Friedensoperationen, in der Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik nach.
Da elicitive Konflikttransformation als internationale Praxis speziell trainiertes Fachpersonal erfordert, setzt sich dieser Band darüber hinaus, nur im deutschsprachigen Original, auch ausführlich mit den curricularen und methodisch-didaktischen Erfordernissen einer akademischen Ausbildung speziell für elicitive Konfliktarbeit auseinander.
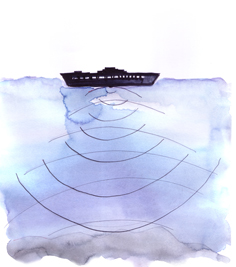
Band 3 (2015) der Variationen über die vielen Frieden befasst sich mit Elicitive Conflict Mapping. Aufbauend auf den philosophischen Grundlagen und den methodisch-didaktischen Überlegungen der vorangegangenen Bände entwickelt dieser dritte Teil im Elicitive Conflict Mapping ein praktisches Werkzeug angewandter Konfliktarbeit, das bei Abraham Maslows Bedürfnishierarchie ebenso Anleihe nimmt wie bei Marshall Rosenbergs Non-Violent Communication, Tony Buzan’s Mindmapping, John Paul Lederachs Konfliktpyramide, Carl Rogers Gesprächstherapie bis hin zum Continental Staff System als Organisations-Schema von militärischen und quasi-militärischen Einrichtungen in der zivilen Friedensarbeit. In erster Linie baut es aber natürlich auf elicitive Konflikttransformation als Arbeitsprinzip.
ECM will nicht mehr als ein Werkzeug sein. Es ist eine Möglichkeit im praktischen Umgang mit Konflikten, keine Wahrheit, kein Weg, keine Norm. Es bietet sich zum Gebrauch an, wo es sinnvoll und zielführend eingesetzt werden kann. Das wird üblicherweise im größeren Kontext elicitiver Arbeitszugänge der Fall sein.
Die Methode wird im ersten Teil des Buches hergeleitet, begründet und beschrieben. Ihre Anwendung vom intrapersonalen Konflikt, über persönliche zwischenmenschliche Konflikte bis zum großen politischen Feld in allen Zusammenhängen wird anschließend dargelegt.
Im zweiten Teil wird die Methode anhand konkreter Lernbeispiele, die aus Theater, Film und Literatur bekannt sind, getestet. Die Leserschaft kann sich auch selbst an dieser Beispielen versuchen.

Die Nachbemerkungen wurden den Variationen über die vielen Frieden unter dem Titel Der die das Frieden als kleineres Bändchen nachgereicht. Neben Aktualisierungen und Ergänzungen zu den älteren Bänden der Trilogie bietet es vor allem den Vorschlag eines friedenspolitischen Wechsels vom subjektorientierten Sprechen, wie es alle modernen Grammatiken Europas aus dem Altgriechischen verbindlich abgeleitet und im Zuge ihrer Kolonialpolitik außereuropäischen Kontexten aufgezwungen haben, hin zu einem handlungs- und geschehensorientierten Sprechen.
Das wird in vielen wichtigen und großen Kultursprachen auf allen Kontinenten außerhalb Europas selbstverständlich gepflegt. In diesen Sprachen kann grammatisch richtig gesagt werden, dass es friedet. Das kann sich auf soziale Zusammenhänge zwischen Individuen oder Gruppen von Menschen beziehen. Ebenso auf das Verhältnis zwischen Mensch und Mitwelt oder überhaupt auf Verhältnisse und Prozesse in der Natur.
Grammatik setzt unserem Denken über die Welt solide Grenzen. Daher kann ein veränderter Umgang mit grammatischen Formen dem Verstehen und Handeln gänzlich neue Felder öffnen. Die rasche Abfolge von ernsten Krisen in der Sozial-, Umwelt-, Klima-, Bildungs-, Ernährungs- oder Gesundheitspolitik am europäischen Kontinent lädt zum Versuch, den begrenzten Horizont durch anderes Sprechen über das Frieden zu erweitern.
Denn Frieden kommt nicht vom bloßen Fordern, er kommt nur, wenn wir ihn tun. Das hat André Heller schon 1982 in seiner Nachbemerkung[1] der Friedensbewegung gesungen,
Vier Jahrzehnte später meint die Nachbemerkung zur Trilogie über die vielen Frieden, dass es frieden nur kann, wenn wir es zulassen, wahrnehmen und tun.
[1] Heller, Andre: Stimmenhören [EMI Electrola GmbH, Wien, LP 7-92246-1/ CD 7 92246 2] 1982.
