Die Innsbrucker Schule der Friedensforschung

Die Innsbrucker Schule der Friedensforschung hatte nie eine Adresse, stand nicht im Telefonbuch und verfügte über keine Geschäftsführung. Ähnlich der historischen Chicagoer Schule der Soziologie, der Pariser Schule der Medizin, der Wiener Schule der Musik oder der Frankfurter Schule der Philosophie gab es keine Institution oder Organisation unter diesem Namen. Der Begriff entstand als informelle Bezeichnung jenes akademischen Zusammenhangs, der sich seit der Jahrtausendwende im Umfeld des Universitätslehrgangs für Friedensstudien an der Universität Innsbruck bildete.
Ausgangspunkt war die post-strukturalistische Abkehr von der gängigen Vorstellung des einen Friedens als metaphysisches Singularetantum. Darauf baute die Orientierung an den vielen situativen, relationalen und dynamischen Frieden im Plural. Dies ergab unterschiedliche friedensphilosophische Ansätze und Methoden. Aus denen wiederum folgten praktische Konsequenzen für die angewandte Konfliktarbeit sowie curriculare und didaktische Überlegungen für Friedensstudien. Dies alles fasst unscharf die Innsbrucker Schule zusammen.
Manchmal ersetzt diese Bezeichnung also einfach den etwas sperrigen Begriff transrationale Friedensphilosophie. Er bezieht sich auch auf elicitive Konflikttransformation als Arbeitsweise. Die spielte in dem Zusammenhang eine große Rolle, obwohl sie keine originäre Schöpfung der Innsbrucker Schule ist. Sie geht auf John Paul Lederach zurück und ist vielerorts in Verwendung. Gelegentlich bezieht sich der Begriff auch auf experimentelle, erfahrungs- und körperorientierte Formen des akademischen Lernens in Gruppen. Dieses machte das Friedensstudium an der Universität Innsbruck bekannt.

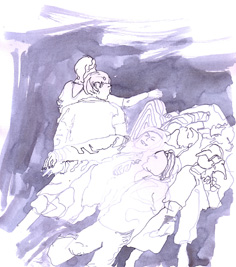
Der Universitätslehrgang für Frieden, Entwicklung, Sicherheit und Internationale Konflikttransformation wurde 2001 als Master im Rahmen der universitären Weiterbildung nach den §§ 23-26 Universitätsstudiengesetz 1997 eingerichtet. Von Beginn an wurde er nach den Kriterien des damals brandneuen Bologna-Prozesses für einen Europäischen Hochschulraum gestaltet. Nach einem Pilotsemester wurde das Curriculum formal an das Universitätsgesetz 2002 angepasst.
2012 erfolgte eine Aktualisierung des Curriculums. Die Innsbrucker Peace Studies wurden 2022 als erster Universitätslehrgang der österreichischen Universitätsgeschichte von der Weiterbildung in ein Regelstudium übertragen. Das belegte seine herausragende akademische Bedeutung, beendete aber zugleich die informelle Geschichte der Innsbrucker Schule. Viele ihrer Charakteristika wurden ab nun von den Anforderungen an ein Regelstudium überlagert.

2008 wurde der UNESCO Chair, 2017 der Arbeitsbereich und 2018 das interdisziplinäre Forschungszentrum an der Universität Innsbruck eingerichtet. Stets war aber der am Bildungsinstitut Grillhof in Vill durchgeführte Master-Lehrgang Kristallisationspunkt der Innsbrucker Schule.
Dort organisierte sich die Kerngruppe um Wolfgang Dietrich, Norbert Koppensteiner, Daniela Ingruber und Josefina Echavarria, die 2011 gemeinsam mit Gustavo Esteva, dem Rektor der Universidad de la Tierra in Oaxaca/Mexiko, das Palgrave International Handbook of Peace Studies: A Cultural Perspective herausgaben. Das war eine richtungsweisende Publikation der Innsbrucker Schule, die von der Fachwelt als festival of epistemologies, ideas, and philosophies (Alberto Gomes/Australien) gefeiert wurde. John Paul Lederach schrieb: No other book of peace studies provides such a rich, in depth, and wonderfully interactive conversation about our many understandings and lived cultural etymologies around a single word [ ] An extraordinary balance and contribution to a field overly dominated by narrow academic definitions, a must for our classes and bookshelves.

Schon 2006 hatten Dietrich, Echavarria und Koppensteiner die dreisprachige Sammlung von Schlüsseltexten der Friedensforschung/ Key Texts of Peace Studies/ Textos claves de la Investigación para la Paz herausgegeben.
Zur informell so genannten Core Faculty zählte ein im Laufe der Jahre wechselnder Personenkreis. Langfristig engagierten sich Belachew Gebrewold, Florencia Benitez-Schäfer, Andreas Oberprantacher, Fabian Patrick Mair, Birgit Allerstorfer, Paula Ditzel Facci, Catalina Vajello Piedrahita, Noah B. Taylor, Shawn R. Bryant, Karin Michalek und Sabrina Stein. Am Grillhof trafen sie sich mit den ersten Direktoren des Masters, Anton Pelinka und Alan Scott.

Rasch entstand ein weltweiter Austausch von Studierenden und Lehrenden. Unter den vielen Gastvortragenden waren beispielsweise Johan Galtung, Ekkehart Krippendorff, Peter Waldmann, Wolfgang Sachs, Chantal Mouffe, Ervin Laszlo, Wolfgang Sützl, Jenny Pearce, Hilary Cremin, Jennifer Murphy, Annette Weber, Isabelle Duquesne, Ed Brantmeier, Sikander Mehdi, Christopher Mitchell, Alberto Gomes, Walt Kilroy oder Gal Harmat. Die Begegnung mit ihnen und anderen mehr bildete den dynamischen Marktplatz der Ideen für die Innsbrucker Schule. Daraus folgten Projekte und Kooperationen in Forschung, Lehre und Praxis mit Universitäten und anderen Institutionen auf allen Kontinenten.
Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die der angewandten Konfliktarbeit verpflichtet sind, vereinte deren Expertise mit dem akademischen Anspruch. Dies schuf außergewöhnliche Lernerfahrungen. So wurden mit dem Österreichischen Bundesheer und seinen felderfahrenen Offizieren unter Generalmajor Herbert Bauer über jeweils mehr als eine Woche hinweg zivil-militärische Einsätze simuliert. Mit dem Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Wasser- und Höhlenrettung wurde geübt. Im Rahmen des team building, leadership und relationship trainings unternahm man Rafting Touren oder Höhlenwanderungen. Der Film Masters of Peace von Sananda Kirschner hielt 2014 einiges davon fest.

Die Innsbrucker Schule wurzelte inhaltlich und methodisch in den Überlegungen postmoderner Philosophie, interpretativer Ethnologie, demokratischer Pädagogik, humanistischer Psychologie und Person-zentrierter Psychotherapie. In der Buchreihe Elicitiva – Friedensforschung und humanistische Psychologie, die von Matthias Gossner redaktionell betreut wurde, ließ der UNESCO Chair prominente Stimmen dieser Denkrichtung zu Wort kommen. Auch in der Reihe Die Kommende Demokratie, in der unter anderen Daniela Ingruber und Maria Dalhoff publizierten, ging es um diese Themen.
Introspektive und körperorientierte Elemente spielten eine prominente Rolle. Das Curriculum sah dafür einen eigenen Modul vor. Gastlehrende wie Augusto Boal, David Diamond, Armin Staffler, Birgit Fritz, Sylvester Walch, Albrecht Mahr und Winfried Wagner unterrichteten dort. An der Native Spirit Wildnisschule oder mit dem Lalish Theaterlabor wurde gearbeitet.
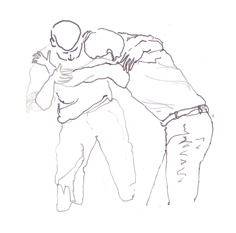
In Innsbruck stand für diesen Aspekt besonders die Arbeit von Norbert Koppensteiner. Seinen Zugang zur Friedensforschung legte er schon 2009 in The Art of the Transpersonal Self an. Ein Jahrzehnt später spiegelte das Buch Transrational Peace Research and Elicitive Facilitation. The Self as (Re)Source die Erfahrung, die er als langjähriger Programmkoordinator, besonders aber das methodische und didaktische Verständnis, das er als Lehrender in Innsbruck gewonnen hatte. Und es weist schon darüber hinaus.
Gemeinsam mit Josefina Echavarria und Daniela Ingruber gab Koppensteiner 2018 Transrational Resonances heraus. Das ist ein Sammelband, der die unterschiedliche Denkweise vieler Mitwirkenden am Innsbrucker Kreis illustriert.
Schon 2014 hatte das Journal of Conflictology in Barcelona der Innsbrucker Schule ein Schwerpunktheft gewidmet. 2019 setzte sich ein von Hanne Tjersland und Paula Ditzel Facci herausgegebenes Sonderheft des Journal of Peace Education unter dem Titel Transrational Perspectives in Peace Education weiter damit auseinander. Die Herausgeberinnen, Dietrich, Bryant, Echavarria und Taylor publizierten gemeinsam mit Hilary Cremin, Kevin Kester und Tim Archer von der Cambridge University in diesem Band. Dieses exzellente Zeugnis über die Innsbrucker Schule in ihrer reifsten Ausformung wurde 2024 von Routledge als Buch neu aufgelegt.
Ditzel Faccis Dancing Conflicts, Unfolding Peaces. Movement as Method to Elicit Conflict Transformation befasst sich 2020 mit einer in Innsbruck prominenten Form der Körperorientierung.


Die Innsbrucker Schule erreichte in dieser Zeit weltweite Aufmerksamkeit. Es gab Einladungen rund um den Globus, um den innovativen Ansatz in der universitären Lehre und in der praktischen Konfliktarbeit zu testen. Am nachhaltigsten schlug sich das wohl bei Paz & Mente in Brasilien und Al Amal im Irak nieder.
Josefina Echavarria, Adham Hamed und Noah Taylor schrieben darüber in Elicitive Curricular Development: A Manual for Scholar-Practitioners Developing Courses in International Peace and Conflict Studies.
Noah Taylor und Shawn Bryant publizierten Some Reflections on Elicitive Approaches to Peace Studies in Higher Education. Taylor und Bryant betreiben auch gemeinsam einen Youtube Kanal unter dem Titel Transrational Perspectives. In zahlreichen Videos werden dort Themen diskutiert, die alle inhaltlich der Innsbrucker Schule zugeordnet werden können. Taylor veröffentlichte 2023 das Buch Existential Risks in Peace and Conflict Studies, in dem er den Innsbrucker Ansatz mit Fragen von Frieden und Risiken des menschlichen Überlebens verbindet.
Mit den rechtswissenschaflichen Aspekten des Innsbrucker Ansatzes befassten sich Catalina Vallejo Piedrahita und Florencia Benitez-Schäfer, die 2014 auch neben Dietrich und Echavarria im Journal for Conflictology zu diesem Thema publizierte. Schon zuvor, im Jahr 2013, hatten Benitez-Schäfer und Vallejo Piedrahita gemeinsam mit Bryant und Taylor Conflicting Peaces: Engaging with Diversity in Friction im International Journal of Community Diversity publiziert. Vallejo Piedrahitas 2024 publizierter Aufsatz Making Peace with the Rights of Nature: New Tools for Conflict Transformation in the Anthropocene weist eindrucksvoll in die Zukunft dieser Denkschule.
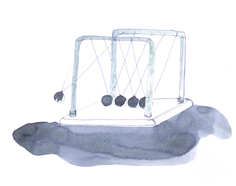
Seit 2010 erhielten auch die Graduierenden vom Innsbrucker Universitätslehrgang die Gelegenheit, herausragende Master-Arbeiten in der Reihe Masters of Peace zu veröffentlichen. Die erschien zuerst bei LIT, dann bei Springer und schließlich open access bei IUP.

Die Alumni der Innsbrucker Schule blieben nach den intensiven Erfahrungen des gemeinsamen Lernens meist eng vernetzt. Sie organisierten sich untereinander für unterschiedliche Ziele. Unter anderem gründeten sie das Many Peaces Magazine, in dem sie seit 2014 ihre Sicht der Innsbrucker Schule weiter diskutieren. Sie betriebenen selbst den Peace Studies Fonds zur Unterstützung der nachrückenden Jahrgänge im Studium. Es gab und gibt mehrere Initiativen zur gemeinsamen Gestaltung thematischer Workshops.

Mit dem Auslaufen des Universitätslehrgangs und der Überleitung ins Regelstudium gingen personelle Veränderungen einher. Die meisten der oben genannten Personen entwickeln heute anderswo den einstigen Innsbrucker Ansatz auf ihre jeweilige Weise weiter. Wolfgang Dietrich reflektiert in seiner Brahmacharria Frieden als Geschehen und Tun in systemischen Zusammenhängen:

